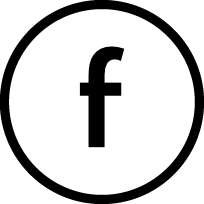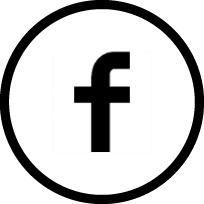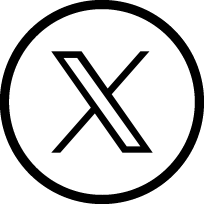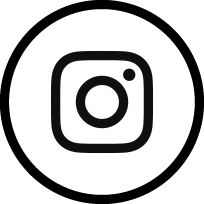04.11.2019
«20 Eritreer sollen die Schweiz verlassen» – dies titelten am 3. September 2018 mehrere Schweizer Zeitungen, darunter der Tagesanzeiger, unter Verweis auf eine Medienmitteilung des Staatssekretariats für Migration (SEM). Sie bezogen sich auf ein Pilotprojekt des Staatssekretariats, im Zuge dessen die vorläufige Aufnahme von rund 250 Personen überprüft worden war.
In neun Prozent der Fälle – die erwähnten zwanzig Personen – entschied die Behörde, dass die Voraussetzungen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes nicht mehr erfüllt sind. Weitere 2’800 Fälle wurden in den folgenden Monaten bis Mitte 2019 geprüft. Für die von einer Aufhebung Betroffenen bedeutet dies, dass sie ihren Aufenthaltstitel verlieren und die Schweiz verlassen müssen.
Dieser Schritt ist die Folge von langjährigem politischem Druck, Militärdienstverweigerer/-innen vom Aufenthaltsrecht in der Schweiz auszuschliessen. Opfer dieser Politik sind jene Eritreer/innen, die zwischen Stuhl und Bank enden, wie ein Blick auf die Entwicklungen seit der Jahrtausendwende zeigt.
Früher Widerstand gegen die «liberale» Rechtsprechung der Asylrekurskommission
Im Dezember 2005 beschäftigte sich die Asylrekurskommission (ARK), damals höchste Schweizer Instanz in Fragen des Asylrechts, mit der Lage in Eritrea: In einem Grundsatzurteil stellte sie fest, dass der eritreische Staat Personen, welche den Militärdienst verweigern, aus politischen Gründen unverhältnismässig streng bestraft. Sie bejahte eine Verfolgung gemäss den Kriterien des Asylgesetzes und entschied, dass betroffene Personen als Flüchtlinge anzuerkennen seien. Durch den Entscheid der Kommission wussten sich viele Eritreer/innen vor weiterer Verfolgung in Sicherheit.
Doch schon bald regte sich von politischer Seite erste Kritik am höchstrichterlichen Urteil. Namentlich die Schweizerische Volkspartei (SVP) störte sich an der steigenden Zahl der Asylgesuche aus Eritrea, die sie wesentlich auf die Rechtsprechung der Asylrekurskommission zurückführte.
Im März 2007 regte Nationalrätin Jasmin Hutter-Hutter (SG/SVP) in der Interpellation «Massive Zunahme der Asylgesuche aus Eritrea» an, Dienstverweigerung und Desertion als Asylgründe gesetzlich auszuschliessen. Obwohl dies bereits damals der Praxis der Gerichte entsprach – Dienstverweigerer/-innen wurden lediglich dann als Flüchtlinge anerkannt, wenn ihnen eine Bestrafung im Sinne des Asylgesetzes drohte –, wurde im Rahmen der Revision des Asylgesetzes eine neue Bestimmung eingeführt. Diese hielt nun explizit fest, dass Wehrdienstverweigerer/-innen künftig nicht mehr als Flüchtlinge anerkannt werden sollen.
Obwohl die Änderung in Konflikt mit der von der Schweiz ratifizierten Genfer Flüchtlingskonvention stand – diese lässt einen derart pauschalen Ausschluss von aus politischen Gründen verfolgten Personen nicht zu – wurde sie vom Parlament für dringlich erklärt und trat am 29. September 2012 in Kraft. Dagegen wurde nachträglich das Referendum ergriffen, weshalb es am 9. Juni 2013 zur Volksabstimmung kam. Die Revision wurde mit 78 Prozent der Stimmen angenommen.
Das Staatssekretariat für Migration ändert seine Praxis: Freiwilligen Rückkehrern/-innen soll keine erhebliche Strafe mehr drohen
Der Widerspruch zwischen Asylgesetz und Flüchtlingskonvention blieb praktisch deshalb gering, weil die neue Bestimmung einen Vorbehalt betreffend die Geltung derselben postulierte. Damit konnten die Gerichte den Flüchtlingsstatus weiterhin auch im Falle von Wehrdienstverweigerung feststellen, sofern eine Verfolgung im Sinne der Flüchtlingskonvention drohte. Jedoch ist die symbolische Strahlkraft der Änderung nicht zu unterschätzen: Sie bedeutete den Anfang einer in den Folgejahren immer restriktiveren Praxis im Umgang mit eritreischen Asylsuchenden.
Denn auch nach Inkrafttreten des neuen Asylgesetzes riss die Polemik gegen Eritreer/innen nicht ab. Im Parlament wurden Motionen, Postulate und Interpellationen eingereicht – von 2014 bis heute war «Eritrea» Thema von sage und schreibe 106 Geschäften. Im Februar 2016 reiste eine überparteiliche Gruppe von Parlamentariern/-innen nach Eritrea. Kurz darauf reichte Nationalrat Heinz Brand (GR/SVP), bezugnehmend auf ebenjene Reise, eine weitere Interpellation mit dem Titel «Weiteres Vorgehen betreffend Eritrea» ein. Er forderte unter anderem den Abschluss eines Rückübernahmeabkommens und stellte die Qualifizierung Eritreas als Diktatur grundsätzlich in Frage.
Ungefähr zur selben Zeit führte auch das Staatssekretariat für Migration zusammen mit deutschen Behörden eine Fact-Finding Mission in Eritrea durch. Wenige Monate später, am 22. Juni 2016, publizierte das Staatssekretariat den Bericht «Focus Eritrea: Update Nationaldienst und illegale Ausreise». Obwohl darin von aussergerichtlichen Strafen in nach wie vor markanter Höhe gesprochen wird und die Ausführungen mit zurückhaltenden Formulierungen und Konjunktiven gespickt sind – dass die Datenlage desolat ist, anerkennt das Staatssekretariat selbst explizit – kommt der Bericht zum Schluss, dass insbesondere freiwilligen Rückkehrern/-innen keine erhebliche Bestrafung droht. Gestützt darauf änderte das Staatssekretariat seine Praxis bei der Prüfung eritreischer Asylanträge.
Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt die neue Praxis
Nicht lange nach der Praxisverschärfung landete der erste Fall vor dem Bundesverwaltungsgericht. Es ging vorerst bloss um die Frage, ob die illegale Ausreise aus Eritrea – das legale Verlassen des Landes ist einem überwiegenden Teil der Bevölkerung gar nicht möglich – ausreicht, um die Flüchtlingseigenschaft zu begründen. Das Gericht verneinte dies in seinem Urteil vom 30. Januar 2017 und bestätigte damit erstmals die neue Praxis des Staatssekretariats für Migration. Dies, obwohl es ebenfalls ausdrücklich festhielt, dass Eritrea quellentechnisch «eine grosse Herausforderung» darstelle und der Staat in vielen Bereichen eine «Blackbox» sei.
In den nächsten rund eineinhalb Jahren folgten zwei weitere Leiturteile. Am 17. August 2017 entschied das Bundesverwaltungsgericht, dass die Rückkehr für Personen, die regulär aus dem Nationaldienst entlassen wurden, grundsätzlich zumutbar ist. In Abkehr der bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Praxis, welche für die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs begünstigende Faktoren verlangte – namentlich das Vorhandensein eines sozialen Netzes im Heimatland, welches die Reintegration erleichterte –, hielt das Gericht fest, dass zwar in Einzelfällen nach wie vor von einer Existenzbedrohung ausgegangen werden könne, hierfür jedoch besondere Umstände (z.B. schwerwiegende, in Eritrea nicht therapierbare gesundheitliche Einschränkungen) vorliegen müssten. Es qualifizierte damit die Rückkehr als grundsätzlich zumutbar.
Schliesslich befand das Bundesverwaltungsgericht in einem weiteren Urteil vom 10. Juli 2018, dass es sich beim eritreischen Nationaldienst nicht um Sklaverei handle, sondern «lediglich» um in der rechtlichen Terminologie weniger schwerwiegende Zwangsarbeit. Im Urteil ist zu lesen, dass die Richter/innen zwar die schwierige Situation nationaldienstleistender Personen anerkennen – der eritreische Nationaldienst dauert in der Regel bis zu 10 Jahre und länger – das Verbot von Zwangsarbeit (Art. 4 Abs. 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention, EMRK) werde jedoch durch die Ausgestaltung des Dienstes in Eritrea nicht seines «essentiellen Gehalts» beraubt. Eine Wegweisung nach Eritrea verletzt deshalb in den Augen des Bundesverwaltungsgerichts die EMRK-Bestimmung auch dann nicht, wenn dem oder der Betroffenen die Rekrutierung droht.
Damit bestätigte das Bundesverwaltungsgericht die neue Praxis des Staatssekretariats für Migration auf ganzer Linie. In den Augen des Gerichts vermag weder die illegale Ausreise die Flüchtlingseigenschaft zu begründen, noch sprechen der drohende Einzug in den Nationaldienst oder die allgemeine Lage in Eritrea gegen den Wegweisungsvollzug. Gegen einzelne Leiturteile sind derzeit noch Beschwerden bei internationalen Instanzen hängig.
Vorläufige Aufnahme Tausender wird überprüft, der politische Druck nimmt weiter zu
Parallel zur geänderten Rechtspraxis bewegt sich auch die Politik. So forderte beispielsweise Ständerat Damian Müller (LU/FDP) in seiner Motion «Umsetzung einer fairen Asylpolitik in Bezug auf Eritrea», es seien «so viele vorläufige Aufnahmebewilligungen wie möglich aufzuheben». Zudem solle das Staatssekretariat für Migration in einem Bericht Gründe für allfällige Nichtaufhebungen aufzeigen. Die Bundesversammlung nahm die Motion mit einer deutlichen Mehrheit an.
Durch das Bundesverwaltungsgericht bestätigt und von der Politik dazu aufgefordert, plante das Staatssekretariat für Migration den vorerst letzten Schritt in der Causa Eritrea: Es überprüfte die vorläufigen Aufnahme von Personen, deren Asylgesuche vor der beschriebenen Praxisverschärfung behandelt worden waren, zunächst im Rahmen eines Pilotprojekts bei rund 250 Betroffenen, anschliessend in tausenden weiteren Fällen.
Die Rückkehr von abgelehnten Asylsuchenden bleibt illusorisch
Eine Rückkehr der Betroffenen in ihr Heimatland dürfte jedoch in naher Zukunft an verschiedenen Faktoren scheitern: In Eritrea herrscht seit der Unabhängigkeit im Jahr 1993 eine Übergangsregierung unter der Führung des autoritären Staatspräsidenten Isayas Afewerki. Die Menschenrechtslage im Land ist prekär, und sämtliche Bürger/innen sind verpflichtet, einen zeitlich grundsätzlich nicht beschränkten Nationaldienst zu leisten. Deserteuren/-innen drohen lange Haftstrafen und teilweise Folter. Personen, die das Land ohne Erlaubnis der Regierung illegal verlassen – was auf die meisten in der Schweiz vorläufig aufgenommenen Eritreer/innen zutreffend dürfte – gelten als Republikflüchtlinge. Sollten sie zurückkehren wollen, drohen ihnen Verhaftung und eine zeitlich unbestimmte Haft.
Mit Eritrea besteht bis zum heutigen Zeitpunkt kein Rückübernahmeabkommen und auch sonst waren die diplomatischen Beziehungen aufgrund der untragbaren Situation im Land lange Zeit auf Eis gelegt – wenn auch in dieser Hinsicht zunehmend Forderungen laut werden, die Beziehungen wieder auszubauen. Derzeit jedenfalls weigert sich die Regierung des ostafrikanischen Landes nach wie vor, eigene Staatsbürger/innen zurückzunehmen, die gegen ihren Willen aus der Schweiz ausgeschafft werden sollen. Hierauf weist auch das Bundesverwaltungsgericht in seinen Urteilen hin und beurteilt deshalb die zwangsweise Rückführung als «generell nicht möglich».
Anderseits ist aber zu erwarten – was auch durch die bisher bekannten Zahlen bestätigt wird –, dass Eritreer/innen nur in den seltensten Fällen freiwillig in ein Land zurückkehren werden, in welchem ihnen Zwangsarbeit und unter Umständen Folter, jedenfalls aber eine mit der Menschenwürde kaum vereinbare Versorgungslage droht.
Katastrophale Folgen für die Betroffenen
Die vom Staatssekretariat für Migration vorgenommene Praxisverschärfung basiert auf einer äusserst dünnen Faktenlage. Obwohl das Bundesverwaltungsgericht in den Urteilen wiederholt betont, dass nur unzureichende Daten über die Situation vor Ort existieren, bestätigt es den Kurswechsel im Ergebnis. Doch was bedeutet dies für die Betroffenen?
Wird ein Asylgesuch abgelehnt oder ein einst erteilter Aufenthaltstitel entzogen, müssen die Betroffenen die Schweiz grundsätzlich verlassen. Tun sie dies nicht, gelten sie als illegal in der Schweiz anwesend, und ihnen drohen regelmässige Kontrollen, administrative Massnahmen und Bussen wegen illegalem Aufenthalt. Sie unterliegen ausserdem einem strikten Arbeitsverbot und verlieren ihren Anspruch auf Sozialhilfe respektive Asylfürsorge.
In dieser Situation haben Personen lediglich noch Anspruch auf Nothilfe. Damit soll das absolute Existenzminimum – Obdach, Nahrung, Kleidung und medizinische Notversorgung – sichergestellt werden. Die Ausrichtung ist kantonal unterschiedlich, geschieht jedoch regelmässig durch die Aushändigung von Gutscheinen und Materialien respektive der Unterbringung in (Kollektiv-)Unterkünften auf engstem Raum. Dennoch muss davon ausgegangen werden, dass die meisten Eritreer/innen selbst diese prekären Verhältnisse einer Rückkehr in ihr Heimatland vorziehen.
Weiterführende Informationen
- 20 Eritreer sollen die Schweiz verlassen
Tagesanzeiger, 3. September 2018 - Pilotprojekt zur Überprüfung der vorläufigen Aufnahmen aus Eritrea abgeschlossen
Medienmitteilung des Staatssekretariats für Migration, 3. September 2018 - Eritreer*innen in der Schweiz: Chronologie einer Debatte
Institut für Politikwissenschaft (IPZ) der Universität Zürich, 2018