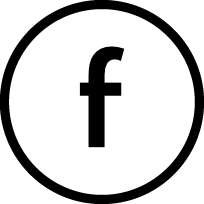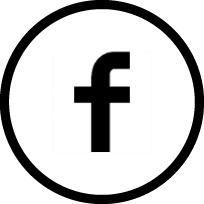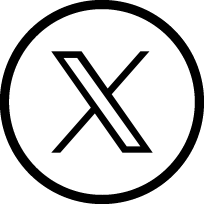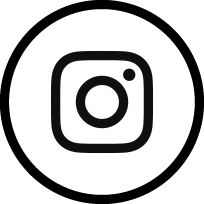09.11.2020
Die fürsorgerischen Zwangsmassnahmen sind eines der dunkelsten Kapitel der Schweizer Sozialgeschichte. Die nun beschlossenen Wiedergutmachungsmassnahmen sind aus menschenrechtlicher Sicht nicht ausreichend. Auch auf der politischen Bühne haben sie grosse Diskussionen ausgelöst.
Bis 1981 wurden in der Schweiz unzählige Personen fürsorgerischen Zwangsmassnahmen unterzogen. Kinder wurden in Pflegefamilien fremdplatziert und Erwachsene in Haftanstalten eingesperrt, ohne dass sie ein Delikt begangen hätten. Andere Betroffene wiederum wurden zwangssterilisiert und unzählige Frauen zu Abtreibungen oder Zwangsadoptionen gezwungen. Die Möglichkeit, gerichtlich gegen diese staatlichen Massnahmen vorzugehen, blieb den Opfern verwehrt. Lange hat die offizielle Schweiz dieses dunkle Kapitel totgeschwiegen, bevor 2013 eine erste Entschuldigung durch den Bundesrat erfolgte.
Nachdem 2014 die Volksinitiative «Wiedergutmachung für Verdingkinder und Opfer fürsorgerischer Zwangsmassnahmen (Wiedergutmachungsinitiative)» eingereicht worden war, nahm auch die parlamentarische Debatte ihren Lauf. Die beiden Räte einigten sich auf einen indirekten Gegenvorschlag. Daraufhin zogen die Initianten/-innen am 27. Januar 2017 ihre Initiative zurück, damit endlich eine Wiedergutmachung gesprochen werden konnte.
Im Rahmen des Bundesgesetz über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981 (AFZFG) wurde neben der finanziellen Wiedergutmachung mittels eines Solidaritätsbeitrages auch die historische Aufarbeitung sowie die Beratung von Betroffenen und der uneingeschränkte Zugang zu den Archiven für die Opfer und ihre Angehörigen vorgesehen.
Verrechnung des Solidaritätsbeitrags mit Ergänzungsleistungen sorgte für Kritik
Der Solidaritätsbeitrag soll den Opfern fürsorgerischer Zwangsmassnahmen eine Wiedergutmachung sowie eine gewisse finanzielle Entlastung bringen. Viele Betroffene leiden nach wie vor an den psychischen und physischen Folgen ihrer Erfahrungen und sind finanziell oftmals nicht gut gestellt. Der Solidaritätsbeitrag verfehlte in seiner ursprünglichen Form jedoch teilweise sein Ziel, wie das folgende Fallbeispiel zeigt.
Eine heute 89 Jahre alte Betroffene war in ihrer Kindheit als Verdingkind ein Opfer der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen. Die Betroffene bezieht, zusätzlich zur den Leistungen der AHV, Ergänzungsleistungen der Wohngemeinde. Aufgrund ihres Antrags wurde ihr der Solidaritätsbeitrag von 25'000 Franken zugesprochen. Die zuständige Sozialversicherungsbehörde beschied ihr jedoch, dass der Solidaritätsbeitrag nicht als Einkommen, sondern als Vermögen angerechnet wird. Dies führte dazu, dass die Hälfte ihres monatlichen Ergänzungsleistungsbeitrags gestrichen und ein entsprechender Betrag – rückwirkend – zurückgefordert wurde. Der Solidaritätsbeitrag hat somit für diese Betroffene keineswegs den Charakter einer Wiedergutmachung oder einer nachhaltigen finanziellen Entlastung.
Doch wie war das möglich? Im entsprechenden Merkblatt des Bundesamtes für Justiz wurde festgehalten, dass der Solidaritätsbeitrag grundsätzlich nicht zu einer Kürzung von Ergänzungsleistungen oder der Sozialhilfe führen dürfte. Jedoch würde eine Kürzung dann vorgenommen, wenn der Solidaritätsbeitrag, zusammen mit dem vorhandenen Vermögen, die Grenze von 37'500 Franken (Alleinstehende) oder 60'000 Franken (Ehepaare) übersteigt.
Starre Fristen: Viele Opfer erhielten keinen Zugang zum Solidaritätsbeitrag
Dass die vom Parlament und dem Bundesrat verabschiedete ursprüngliche Strategie zur Wiedergutmachung für die Opfer zu unschönen Überraschungen führte, zeigt auch ein zweites Beispiel: Ein Mann, der mittlerweile in Deutschland lebt, war in seiner Kindheit Opfer fürsorgerischer Zwangsmassnahmen geworden. Er reichte das Gesuch für den Solidaritätsbeitrag rund zweieinhalb Monate zu spät ein, da er erst im März 2018 – durch die Zeitschrift «Schweizer Revue» – von der Möglichkeit eines entsprechenden Antrags erfahren hatte. Doch das Bundesamt für Justiz lehnte den Antrag mit Verweis auf die verstrichene Frist ab: gemäss Artikel 2 Absatz 1 AFZFV mussten Gesuche bis zum 31. März 2018 eingereicht werden. Daraufhin wandte sich der Mann an das Bundesverwaltungsgericht, welches die Wiederherstellung der Frist verweigerte. Der Betroffene hätte nicht genügend dargelegt, weshalb er sich nicht über die geltende Rechtslage hatte informieren können. In seinem Urteil verweist das Bundesverwaltungsgericht auf zwei hängige parlamentarische Vorstösse (18.4295 und 19.471), die eine Verlängerung der Fristen fordern – unter Umständen könne der Beschwerdeführer zu einem späteren Zeitpunkt ein neues Gesuch stellen.
Das Parlament hat reagiert
Das Parlament hat den notwendigen Handlungsbedarf in diesen beiden Bereichen erkannt und sich in der Wintersession 2019 für eine Änderung des entsprechenden Bundesgesetzes (AFZFG) ausgesprochen. Der Solidaritätsbeitrag führt, seit die Referendumsfrist am 9. April 2020 ungenutzt abgelaufen ist, zu keiner Kürzung von Ergänzungsleistungen oder der Sozialhilfe mehr.
Auch bezüglich der kurzen und heute bereits abgelaufenen Frist zur Einreichung von Gesuchen hat sich etwas bewegt: Die Rechtskommission des Ständerates sprach sich in einem Bericht einstimmig für die parlamentarische Initiative aus, welche die Aufhebung der im Gesetz vorgesehenen Frist vorsieht. Der Bundesrat erklärte sich damit einverstanden. Am 19. Juni 2020 beschloss das Parlament schliesslich, die Frist ersatzlos zu streichen. Die entsprechende Gesetzesänderung trat am 1. November 2020 in Kraft.
Unabhängige Expertenkommission fordert weitergehende finanzielle Beiträge
Der Bundesrat hatte im November 2014 eine Unabhängige Expertenkommission (UEK) eingesetzt, um dieses unrühmliche Kapitel der Schweizer Sozialgeschichte aufzuarbeiten. Dabei hat die UEK insbesondere die administrative Versorgung bis 1981 untersucht, daneben aber auch andere Formen fürsorgerische Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen in ihrer Arbeit berücksichtigt.
Im September 2019 hat die Expertenkommission nun ihren Schlussbericht präsentiert und zeigt darin neben der wissenschaftlichen Aufarbeitung der Geschehnisse auf, welche zusätzlichen Massnahmen nötig wären, um den Opfern von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen eine echte Wiedergutmachung gewährleisten zu können.
Die UEK legt in ihrem Bericht dar, dass viele Betroffene auch heute noch an Spätfolgen leiden. Die willkürlichen Fremdplatzierungen von Kindern sowie die administrativen Versorgungen, einhergehend unter anderem mit Gewalt und (sexueller) Misshandlung, fehlenden Bildungsmöglichkeiten und desolater gesundheitlicher Versorgung, haben vielen Opfern den Einstieg und die Integration in die Gesellschaft und die Berufswelt erschwert, teilweise gar verunmöglicht. Die Spätfolgen schlagen sich, laut UEK, in physischen und psychischen Beschwerden, wie auch in finanziellen Notsituationen nieder.
Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Expertenkommission über die Solidar- und Nothilfebeiträge hinausgehende finanzielle Beiträge, um den Betroffenen die soziale Integration in die Gesellschaft zu erleichtern. Ebenso fordert sie, dass die Frist zur Einreichung von Anträgen aufgehoben wird. So könnten Opfer dieser fürsorgerischen Zwangsmassnahmen auch zu einem späteren Zeitpunkt noch einen Antrag auf den Solidaritätsbeitrag stellen. Zudem sollten Betroffene gemäss UEK gezielt mit Bildungsmassnahmen und mit Unterstützung für eigene Projekte gefördert werden.
Auch wenn eine finanzielle Entschädigung und die weiteren vorgeschlagenen Massnahmen das erlittene Unrecht sowie die psychischen und physischen Narben der Opfer nicht wieder ausgleichen können, ist ein Solidaritätsbeitrag zumindest ein Zeichen des Staates, dass er das begangene Unrecht anerkennt und hierfür eine Wiedergutmachung leistet. Die vorgeschlagenen weiteren Massnahmen der UEK könnten einen zusätzlichen Beitrag leisten, die erlittenen Nachteile zumindest ein wenig auszugleichen und den Zugang zur sozialen und gesellschaftlichen Integration etwas zu erleichtern.
Der jetzt ausbezahlte Solidaritätsbeitrag von maximal 25'000 Schweizer Franken, insgesamt rund 300'000 Millionen Franken, ist im Vergleich zur Aufarbeitung in anderen Staaten gering bemessen. So zeigt beispielsweise der Beobachter auf, dass in anderen Ländern – Irland, Schweden, Deutschland, Kanada und Australien – in welchen ähnliche staatliche Zwangsmassnahmen in Aufarbeitung sind, teilweise höhere Wiedergutmachungszahlungen an die Opfer geleistet werden.
Wiedergutmachung als Teil des Menschenrechtsschutzes
Das Eingeständnis und die historische sowie juristische Aufarbeitung von staatlich begangenem Unrecht rückte in den vergangenen Jahren nicht nur in der Schweiz, sondern auch in weiteren demokratischen Wohlfahrtsstaaten, auf die politische Agenda. Lange Zeit wurden Opfer staatlicher Massnahmen marginalisiert und ihre Aussagen von der Politik sowie grossen Teilen der Bevölkerung nicht gehört. Im Rahmen dieser Aufarbeitungsprojekte werden sie endlich ernst genommen und ihre Geschichten erhalten die ihnen zustehende Aufmerksamkeit.
Mit der Aufarbeitung begangenen Unrechts kommen die Staaten ihren menschenrechtlichen Verpflichtungen nach, da die Wiedergutmachung von staatlich verantworteten Menschenrechtsverletzungen in diversen völkerrechtlichen Verträgen vorgesehen ist. In zeitlicher Hinsicht ergeben sich hierbei jedoch schwerwiegende Probleme. Da Wiedergutmachungen primär auf dem gerichtlichen Weg eingefordert werden müssen, kommen die Regeln des Verfahrensrechts mit den entsprechenden Verjährungs- und Verwirkungsfristen zum Zuge. Wenn begangenes staatliches Unrecht erst Jahre später von den Opfern geltend gemacht wird, ist eine Wiedergutmachung nicht mehr möglich. Die staatliche Pflicht zur Durchsetzung der Menschenrechte und die effektiven verfahrensrechtlichen Möglichkeiten, welche Betroffenen zu Verfügung stehen, klaffen hierbei weit auseinander.
Mittlerweile hat in zentralen Aspekten der Schweizer Geschichte eine Aufarbeitung stattgefunden: So beispielsweise bezüglich der Rolle der Schweiz während des zweiten Weltkriegs, der Rehabilitierung von Fluchthelfern/-innen während des zweiten Weltkriegs, des Verhältnisses der Schweiz zum Apartheidregime in Südafrika sowie zu Kämpfern/-innen des spanischen Bürgerkriegs, oder nicht zuletzt auch die Aufarbeitung des Skandals rund um das «Hilfswerk Kinder der Landstrasse».
Wie viele andere Staaten hat sich die Schweiz bei der Aufarbeitung staatlichen Unrechts aber stets schwer getan. Auch den Opfer fürsorgerischer Zwangsmassnahmen verweigerte sie lange Zeit eine offizielle Entschuldigung. Bei der Wiedergutmachung hat sie sich erneut für eine individuelle Lösung entschieden, welche konkret den Betroffenen fürsorgerischer Zwangsmassnahmen eine finanzielle Entschädigung zuspricht. Damit schafft sie aber kein nachhaltiges System für künftig aufzuarbeitende Themen und entsprechende Lösungen müssen bei Bedarf erneut durch die Politik ausgearbeitet werden. Eine umfassende Wiedergutmachung für Bereiche, die aufgrund von Verjährung gerichtlich nicht mehr einklagbar sind, ist so nicht möglich. Die Betroffenen bleiben damit vollumfänglich abhängig von den politischen Entscheidungsträgern/-innen, die zur gegebenen Zeit darüber befinden, ob eine Wiedergutmachung angebracht ist oder nicht.
Die umfassende Aufarbeitung staatlichen Unrechts erfordert ein systematisches Vorgehen
Im konkreten Fall der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen sind die bisherigen Bemühungen sowie die parlamentarischen Initiativen und die Forderungen der Unabhängigen Expertenkommission zu begrüssen. Für eine effektive Wiedergutmachung, auch in anderen Fällen, sind aber weitere Schritte notwendig. Zu befürworten wäre die Einführung eines Systems staatlicher Wiedergutmachung für begangene Menschenrechtsverletzungen. So könnte eine unabhängige Institution über solche Wiedergutmachungen befinden, wodurch Betroffene ihre Anträge nicht bei den «ehemaligen» Tätern/-innen einreichen müssten. Dies wäre auch deshalb begrüssenswert, weil das Verhältnis vieler Betroffener gegenüber dem Staat von Misstrauen geprägt ist und sie dem direkten Kontakt mit den Behörden meist ausweichen.
Neben der historischen Aufarbeitung, dem Recht auf Zugang zu den vorhandenen Akten für die Opfer, der offiziellen Anerkennung der Schuld sowie der Auszahlung eines Solidaritätsbeitrags, hat keine gerichtliche Aufarbeitung des Systems stattgefunden. Weder mussten sich die Verantwortlichen auf staatlicher Seite, noch die damaligen Leiter/-innen der verschiedenen Institutionen oder die Kirchen, welche viele solcher Heime und Anstalten betrieben hatten, gerichtlich verantworten. Viele Opfer fürsorgerischer Zwangsmassnahmen hätten sich jedoch auch eine gerichtliche Untersuchung und gegebenenfalls die Identifikation und Verurteilung der Verantwortlichen gewünscht.
Umso zentraler ist es deshalb, dass die Schweiz zukünftig ihre Wiedergutmachungspflicht ernst nimmt und umfassende Instrumente zur Verfügung stellt, um historisches Unrecht aufzuarbeiten und den Opfern die notwendige und menschenrechtlich verankerte Wiedergutmachung zu gewährleisten.
Weiterführende Informationen
- Die Schuld der Schweiz
Der Beobachter, 31. März 2014 - Ehemalige Verdingkinder: Das Parlament will eigenen Fehler im Hauruckverfahren korrigieren
NZZ, 5. November 2019 - Vom Umgang mit vergangenem Recht
SKMR-Newsletter, 30. Juni 2014 - Placing Children in Care
SNF-Forschungsprojekt von diversen Hochschulen in der Schweiz - Menschenrechte. Generelle Betrachtungen zur Frage der Wiedergutmachung von Verletzungen, speziell zum Recht auf Erhalt einer Entschädigung
Gutachten der Direktion für Völkerrecht, 10. Juli 2000 (in französischer Sprache / online nicht mehr verfügbar) - Grundprinzipien und Leitlinien betreffend das Recht der Opfer von groben Verletzungen der internationalen Menschenrechtsnormen und schweren Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht auf Rechtsschutz und Wiedergutmachung
Resolution der UNO-Generalversammlung 60/147 vom 16. Dezember 2005 (deutsche Übersetzung)